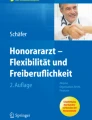Zusammenfassung
In diesem Text werden die Ergebnisse verschiedener Erhebungen zu Veränderungstendenzen des beruflichen Selbstverständnisses von ÄrztInnen im heutigen DRG-Krankenhaus vorgestellt. Untersuchungen zum ärztlichen Selbstverständnis im Kontext der Einführung von Budgetierung (ab 1993) und chirurgischen Fallpauschalen (ab 1996) im Krankenhaus als auch die im Vorfeld der DRG-Einführung im Jahr 2004 publizierten Einschätzungen lassen für die Umstellung auf ein prospektives Krankenhausfinanzierungsystem sowohl spezifische Effekte organisationaler als auch handlungspraktischer Art für die Beschäftigten im Krankenhaus allgemein und für die ärztliche Tätigkeit im Besonderen erwarten. Daher werden die von Experten geäußerten Befürchtungen und aus Studien abgeleiteten Hypothesen bezüglich des Einflusses von DRGs und Budgetierung auf das berufliche Selbstverständnis von ÄrztInnen aufgegriffen und anhand der umfangreichen Daten des WAMP-Projekts und neuerer Untersuchungen auf ihre Gültigkeit überprüft.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Similar content being viewed by others
Notes
- 1.
Die vorliegende Schreibweise von Personenbezeichnungen wird zur Adressierung beider oder mehrerer Geschlechter sowie auf (traditionelle) Geschlechtlichkeiten verweisende Identitäten verwendet.
- 2.
Angesprochen ist hier die Studie von Hirschman, der das Verhalten von Beschäftigten in Krisenzeiten untersuchte, mit dem Ergebnis, dass sich deren Verhalten entlang der drei Kategorien Exit, Voice und Loyalty beschreiben lässt, wobei mit „Loyalty“ die Anpassung an die neue Norm gemeint ist (Hirschman 1970).
- 3.
Eine dritte Möglichkeit, Dissonanzen zu beseitigen, besteht darin, die Exit-Lösung (Arbeitsplatzwechsel) zu wählen, wird jedoch nicht näher betrachtet, da dies zwar eine Rolle im Kontext Ärztemangel spielt, aber nicht für das Thema dieses Beitrags.
- 4.
Die DRGs wurden im Rahmen einer mehrfach verlängerten sog. Konvergenzphase von 2004–2009 eingeführt. Nach Abschluss der Konvergenzphase sollte die Budgetierung der Gesamterlöse eines Krankenhauses abgeschafft werden, dies ist bis heute nicht geschehen.
- 5.
Als ‚prospektiv‘ bezeichnet man ein Vergütungssystem, das Erlöse unabhängig von den realen Kosten definiert, sodass sowohl Gewinne als auch Verluste entstehen können. Dies kann sich sowohl auf den maximal möglichen Gesamterlös (Budgetierung bzw. Deckelung der Gesamterlöse) als auch auf einzelfallbezogene Erlöse (DRGs bzw. Fallpauschalen) beziehen. Vor der Einführung von Budgetierung und DRG-Fallpauschalen galt in der Bundesrepublik ein ‚retrospektives‘ Krankenhausfinanzierungssystem, d. h. die Krankenhäuser konnten erwarten, dass die jeweils tatsächlich verursachten Kosten von den Krankenkassen gedeckt werden (Kostendeckungsprinzip) .
- 6.
Das Projekt ‚Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System‘ wurde vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und dem Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen durchgeführt und von der Hans-Böckler-Stiftung, ver.di, der Gmünder Ersatzkasse (GEK), der Robert Bosch Stiftung und der LÄK Hessen gefördert bzw. unterstützt. Als Wissenschaftler waren Bernard Braun, Petra Buhr, Sebastian Klinke, Hagen Kühn, Rolf Müller und Rolf Rosenbrock an der Durchführung des Projekts beteiligt. In dem Projekt wurden mehrmalige standardisierte Befragungen von ÄrztInnen, Pflegekräften und PatientInnen sowie qualitative Fallstudien in ausgewählten Krankenhäusern durchgeführt (ein Überblick findet sich unter: www.wamp-drg.de).
- 7.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Kapitel teilweise das generische Maskulinum verwendet. Dieses impliziert natürlich immer auch die weibliche Form.
- 8.
Der Begriff der Ökonomisierung beruht maßgeblich auf den Arbeiten von Kühn (vgl. Kap. 8) und meint eine Verkehrung der Zweck-Mittel-Verhältnisse: Während volkswirtschaftlich betrachtet die Ökonomie Mittel bereitstellt, effektiv und effizient gesellschaftliche Zwecke zu befriedigen, wie z. B. die bedarfsdeckende Versorgung mit Gesundheitsleistungen, sind im ökonomisierten Krankenhaus die erbrachten Gesundheitsleistungen Mittel, um betriebswirtschaftliche Zwecke zu verfolgen. Das eine schließt das andere nicht aus, aber anhand dieser Unterscheidung lässt sich theoretisch fassen und empirisch untersuchen, welche Handlungsorientierung sich handlungspraktisch als tendenziell dominant erweist.
- 9.
Diese und alle weiteren Aussagen beruhen primär auf umfangreichen Untersuchungen im Zeitraum der DRG-Einführung aus den Jahren 2003–2010, die im Rahmen des WAMP-Projekts durchgeführt wurden. In den Publikationen finden sich Darstellungen zu Studiendesign, Methoden, Repräsentanz der Befragungen und Dokumentationen des Datenmaterials (vgl. Klinke und Müller 2008; Klinke 2008, 2010; Braun et al. 2010).
- 10.
Diese und alle weiteren zitierten Interviewpassagen (sofern nicht anders angegeben) beruhen auf umfangreichen qualitativen Fallstudien, die in zwei Wellen im Zeitraum der DRG-Einführung in den Jahren 2004 und 2007 im Rahmen des WAMP-Projekts durchgeführt wurden. In Publikationen des WAMP-Projekts finden sich Darstellungen zu Studiendesign und Methoden der Befragungen und Dokumentationen der Transkripte (vgl. Buhr und Klinke 2006a, b; Braun et al. 2010). Die in den zitierten Passagen verwendeten Kürzel ‚B‘ und ‚I‘ beziehen sich auf die jeweiligen Sprecher, so meint ‚B‘ die Befragte/den Befragten, während ‚I‘ den jeweiligen Interviewer/die jeweilige Interviewerin bezeichnet. Am Ende stehen in Klammern jeweils Kürzel zu Funktion und Status des/der Befragten (AA = Assistenzärzt/-ärztin, ÄD = Ärztlicher Direktor/Ärztliche Direktorin, CA = Chefarzt/Chefärztin, OA = Oberarzt/Oberärztin, KL = kaufmännische Leitung, LT Finanzen = Leitung Finanzen), danach folgt das Kürzel für das jeweilige Fachgebiet – hier z. B. HNO = Hals-Nasen-Ohren, die Angabe der Befragungswelle (W1 = 2004/2005 oder W2 = 2007) sowie die Absatznummer(n) im Transkript.
- 11.
Insgesamt wurden drei Befragungswellen (2007 / 2005 / 2004) durchgeführt. Der erste Wert (vor der Klammer) steht für den Prozentwert der jüngsten (dritten) Befragung aus 2007, während in Klammern die gegenüber dieser Befragung gemessenen Veränderungswerte (in Prozentpunkten) der mittleren (zweiten) aus 2005 und der ältesten (ersten) Befragung aus 2004 stehen; bspw. heißt 50 (+4/-2): 50 % in 2007, 46 % in 2005 und 52 % in 2004.
- 12.
Leider sind die Effekte nicht in allen Wellen signifikant; interpretiert werden nur signifikante Werte; dies gilt auch für alle folgenden Regressionsanalysen.
- 13.
Die Gesundheitsreformen der vergangenen Jahre haben zu zahlreichen Einfügungen in das SGB V geführt, die erkennen lassen, dass der Gesetzgeber bemüht ist, diese Leistungsansprüche der Versicherten in Richtung eines Abwägungsgebots zwischen Kosten und Nutzen medizinischer Leistungen für die Leistungserbringer und Kostenträger umzudeuten (Klinke 2005a).
- 14.
Der den Normen des SGB V implizite Begriff von Wirtschaftlichkeit kann als „material rational“ (Weber 1964, S. 60) gekennzeichnet werden, d. h. ökonomisches Handeln orientiert sich an einem ethisch definierten, politisch gesetzten oder vertraglich vereinbarten qualitativen Ziel, wie z. B. dem Ziel der Steigerung der Wohlfahrt aller Bürger. Im Unterschied dazu sind monetär definierte Ziele (Einhaltung eines Budgets oder einer Pauschale, Gewinn usw.), wie sie im Zuge der Gesundheitsreformen Eingang in das SGB V gefunden haben, „formal rational“ im Sinne einer „Rechenhaftigkeit“, deren Ideal die Reduzierung aller Qualitäten auf Geld ist (Weber 1964, S. 60) und damit eine Abwägung machbar und sinnvoll erscheinen lassen. Auch wenn bisher Gerichte im Zweifelsfall einen Primat des Versorgungsgebots vor dem Wirtschaftlichkeitsprinzip bestätigen, bleibt abzuwarten, ab wann die Einfügungen durch weitere Reformen einen Umfang erreicht haben, den Gerichte dann als Normwandel in Richtung eines Abwägungsgebots interpretieren. Ein solches Abwägungsgebot würde dann einem Vorrang formal rationaler Wirtschaftlichkeit vor Bedarfs- und Versorgungsprinzip zur Durchsetzung verhelfen.
- 15.
„Aufsicht“ meint die Kontroll- und Eingriffsbefugnisse („staatliche Ersatzvornahme“, Bieback 1993: S. 205) des Bundesgesundheitsministerium (BMG) und der entsprechenden Landesbehörden gegenüber der Selbstverwaltung (hier: Deutsche Krankenhausgesellschaft und gesetzliche Krankenkassen).
- 16.
Der Begriff „harte Budgetierung“ bezeichnet die verbindliche Festschreibung bestimmter Ausgabengrößen ohne oder mit nur geringem Spielraum für Ausnahmeregelungen (Bieback 1993, S. 205), während mit dem Begriff „weiche Budgetierung“ die Bestimmung von Ausgabenzielgrößen gemeint ist, für deren Überschreitung mehr oder weniger zahlreiche Ausnahmeregelungen existieren.
- 17.
Heinz Rothgang hat in diesem Zusammenhang in Bezug auf die Einführung der Pflegeversicherung die Formulierung „vom Bedarfs- zum Budgetprinzip“ entwickelt (Rothgang 1996). Diese Hypothese kann mittelbar in den Kontext der von anderen Autoren allgemeiner gefassten These einer „Ökonomisierung der Politik“ gestellt werden (Blanke und Kania 1996).
- 18.
Nachdem sich der von Heiner Geißler 1974 geprägte Terminus „Kostenexplosion“ zur Beschreibung der Ausgabensteigerungen im Gesundheitswesen in weiten Kreisen der Politik durchgesetzt hat (Bontrop 1999, S. 84f.), ist sich die Mehrheit der gesundheitspolitischen Akteure darin einig, als Grundlage und Ziel künftiger Gesundheitspolitiken eine einnahmeorientierte Ausgabensteuerung verfolgen zu wollen. Als Legitimation dient in Folge häufig die Annahme von theoretisch tendenziell unendlichen medizinischen Bedarfen, die Formen von Rationierung bzw. Priorisierung unabwendbar und damit notwendig und vernünftig erscheinen lässt.
- 19.
Konstante setzt sich zusammen aus: Assistenzarzt (Position), Männlich, Vollzeit, 200–1000 Betten (Krankenhausgröße), öffentliches KH (Träger), Chirurgie (Fach), keine koordinierten Behandlungen, Haus schrumpft nicht (Situation des Hauses), keine Überforderung durch zu hohes Arbeitspensum (Überforderung), aber keine Wiederwahl Arztberuf (Berufszufriedenheit).
- 20.
Mit Referenzpersonen ist die Zusammensetzung der Konstante in den multivariaten Regressionsrechnungen gemeint (vgl. die jeweilige Legende in den Tabellen).
- 21.
Ein Oberarzt macht, neben der Zunahme an Verwaltungstätigkeiten, diesen Interessenkonflikt zwischen Medizin und Ökonomie auch für eine sinkende Attraktivität des Arztberufes verantwortlich (OA Innere, W1, 23).
- 22.
Ein Chefarzt erlebt die Verwaltung allerdings heute als kooperativer als früher: „[…] heute erlebe ich allerdings die Verwaltung auch eher als zuarbeitend. Gleichwohl glaube ich, dass es immer noch mal ein bisschen besser sein könnte auf manchen Ebenen, aber damals hatten die uns schon eher alleingelassen (CA Chirurgie, W1, 69).“
- 23.
Gemeint sind nicht altersbedingte Komplikationsraten bei knappen Gütern wie Organen, sondern z. B. altersbezogene Annahmen über die Restlebenszeit bei Endoprothesen oder Kinderwunsch/Sexualität bei der Wahl von Krebstherapien.
- 24.
Dieses Verständnis der Aussage wurde in einer Fokusgruppe und bei Referenzpersonen ermittelt.
- 25.
Internistische Fachgebiete (Fachgebiet), > 1000 Betten (Krankenhausgröße), öffentliches KH (Träger), keine Überforderung durch zu hohes Arbeitspensum (Überforderung), gute Situation des Hauses (Situation des H.) und gute Situation der Abteilung (Situation der A.).
- 26.
Durch den Verzicht auf ‚Vorratshaltung‘ im Bereich der Chirurgie müssen im Einzelfall Wartezeiten z. B. auf bestimmte Prothesen in Kauf genommen werden.
- 27.
Medikamentenbeschichtete Koronarstents (Willich et al. 2005) wurden aus Kostengründen, d. h. weil sie von den Krankenkassen nicht bezahlt werden, nicht eingesetzt.
- 28.
Inzwischen übernehmen die Krankenkassen die Kosten von ca. 1000 Euro pro beschichtetem Stent. Neuere Studien haben gezeigt, dass beschichtete Stents nicht für alle Patientengruppen nur Vorteile bedeuten. Eindeutige Vorteile – geringere Rückfallquote – bieten beschichtete Stents für Diabetiker, PatientInnen mit besonders kleinen Herzkranzgefäßen oder bei denen die Verengung der Gefäße besonders lang ist. Gegenüber unbeschichteten Gefäßstützen haben beschichtete Stents den Nachteil, dass die Gefahr von Thrombosen länger anhält und medikamentös verringert werden muss (6 Monate gegenüber 4 Wochen), d. h. die Anforderungen an die Compliance des Patienten sind höher (Hetscher 2006). Gegenwärtig wird anhand weiterer Studien zusätzlich diskutiert, inwieweit die perkutane koronare Intervention (PCI) – auch mit neuer medikamentöser Beschichtung – einer Bypassoperation überhaupt überlegen ist (Park et al. 2015; Bangalore et al. 2015).
- 29.
Kosten für Diagnose können nicht gesondert abgerechnet werden, sondern gelten als mit der jeweiligen DRG-Fallpauschale abgegolten. Das Kostenrisiko trägt das Haus bzw. der behandelnde Arzt, der entscheiden muss, ob er sich seiner Diagnose sicher ist oder weitere differenzialdiagnostische Maßnahmen ergreift, um sich und den Patienten vor einer Fehlbehandlung zu schützen.
- 30.
Ob prästationäre Diagnostik generell positiv für den jeweiligen Patienten ist, wurde in den Interviews nicht hinterfragt. Sofern der eingewiesene Patient durch seine Krankheit bereits stark geschwächt ist, sollte ihm zumindest die Möglichkeit offenstehen, zu entscheiden, ob er auf prästationäre Diagnostik verzichten möchte, um unnötige Belastungen durch Wege und Wartezeiten in der Ambulanz zu vermeiden.
- 31.
Genannt wird von den Befragten ein Zeitraum von 2–3 Tagen bis zur Wiederaufnahme. Offiziell muss allerdings hier ein längerer zeitlicher Abstand eingehalten werden (> 30 Tage und außerhalb oberer Grenzverweildauer), um eine Fallzusammenführung zu vermeiden (Metzger 2004).
- 32.
„Ohne vernünftige Anamnese geht die Arbeitsdiagnose aber in die falsche Richtung, die Diagnostik in die falsche Abteilung und die Therapie zum falschen Patienten.“ Selbst „ob das auch ökonomisch dauerhaft Sinn macht, ist mehr als fraglich“ (Feld 2005).
- 33.
In einem Gespräch mit dem Sachbearbeiter für stationäre Leistungen einer großen Ersatzkasse wurde die diesbezügliche Passivität der Kassen damit begründet, dass man sich in laufende Behandlungen nicht einmische, sondern nur nachträglich die Richtigkeit der Abrechnung des Krankenhauses prüfe. Dies geschehe auch deshalb, weil man im Falle einer Intervention Nachteile in der Behandlung befürchte und somit die Interessen des Patienten schützen wolle. An dieser Stelle zeigt sich, dass die Versicherten, wenn sie zum Patienten geworden sind, nicht oder nicht mehr mit der uneingeschränkten Unterstützung ihrer Kasse rechnen können. Weitere reale Beispiele sind in einem Buch von Stephan Kolb und Caroline Wolf nachzulesen (Kolb und Wolf 2006).
- 34.
Gültig auch für diejenigen ÄrztInnen und Pflegekräfte, die in ihrer Praxis zwar gegen sie verstießen, aber trotzdem die Norm als herrschend anerkannten. Eine Norm ist solange herrschend bzw. gültig, solange sie moralisch die Deutungshoheit besitzt. Beispiel: Solange Diebstahl allgemein als eine unrechtmäßige Handlung betrachtet wird, weiß auch der Dieb, dass er sich gerade ins Unrecht setzt, wenn er etwas stiehlt, was ihn aber nicht daran hindert, die Eigentumsnorm zu verletzen. Wird jedoch die Eigentumsnorm selbst zunehmend als Ursache gesellschaftlicher Missstände in Frage gestellt und damit relativiert, dann wird so mancher Dieb zum Robin Hood und so mancher Manager zum gemeinen Dieb. Bezogen auf das berufliche Selbstverständnis der ÄrztInnen wird demgegenüber dann die Berücksichtigung gewinnwirtschaftlicher Interessen von einem Regelverstoß zu einer Regelbeachtung und die Zurückweisung von Versorgungsansprüchen der PatientInnen wird als legitim angesehen.
Literatur
Bangalore, S., Guo Y. Samadashvili, Z., Blecker, S., Xu, J., & Hannan E. L. (2015). Everolimus-eluting stents or bypass surgery for multivessel coronary disease. New England Journal of Medicine, 372(13),1213–1222.
Bieback, K.-J. (1993). Allgemeine sozial- und verfassungsrechtliche Aspekte des GSG. Zeitschrift für Sozialreform, 38(4),197–218.
Blanke, B., & Kania, H. (1996). Die Ökonomisierung der Gesundheitspolitik. Von der Globalsteuerung zum Wettbewerbskonzept im Gesundheitswesen. Leviathan, 24(4),512–537.
Bontrop, H.-J. (1999). Zu den Irrtümern am Gesundheitsmarkt. Sozialer Fortschritt, 48(4), 84–92.
Borgetto, B. (2006). Ökonomisierung, Verwissenschaftlichung und Emanzipation. sozialersinn, 7(2),231–250.
Braun, B., & Müller, R. (2003). Auswirkungen von Vergütungsformen auf die Qualität der stationären Versorgung. Ergebnisse einer Längsschnittanalyse von GKV-Routinedaten und einer Patientenbefragung, Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, Bd. 26. Sankt Augustin: Asgard.
Braun, B., & Müller, R. (2006). Versorgungsqualität im Krankenhaus aus der Perspektive der Patienten. St. Augustin: Asgard.
Braun, B., Buhr, P., Klinke, S., Müller, R., & Rosenbrock, R. (2010). Pauschalpatienten, Kurzlieger und Draufzahler – Auswirkungen der DRGs auf Versorgungsqualität und Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Bern: Huber.
Bräutigam, C., Evans, M., Hilbert, J., & Öz, F. (2014). Arbeitsreport Krankenhaus. Eine Online-Befragung von Beschäftigten deutscher Krankenhäuser, Arbeit und Soziales: Arbeitspapier Nr. 306. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung.
Buhr, P., & Klinke, S. (2006a). Qualitative Folgen der DRG-Einführung für Arbeitsbedingungen und Versorgung im Krankenhaus unter Bedingungen fortgesetzter Budgetierung, Discussion Papers, Bd. SP I 2006-311. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Buhr, P., & Klinke, S. (2006b). Versorgungsqualität im DRG-Zeitalter. Erste Ergebnisse einer qualitativen Studie in vier Krankenhäusern, ZeS-Arbeitspapier Nr. 6. Bremen: Zentrum für Sozialpolitik.
Feld, M. (2005). Ökonomisierung des Gesundheitswesens: Weiterbildung wird zum lästigen Nebenprodukt. Deutsches Ärzteblatt, 30, A-2128/B-1796/C-1700.
Gerlinger, T., et al. (Hrsg.). (2000). Kostendruck im Krankenhaus. Jahrbuch für Kritische Medizin. Hamburg: Argument.
Hetscher, I. (2006). Die Variante Plus ist nicht immer die bessere. Beschichtete Stents sind nicht für alle Herzpatienten sinnvoll. Weser Kurier, 29.12.2006, 26.
Hirschman A. (1970). Exit, voice, loyalty: Responses to decline in firm, organizations and states. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
Hoffmann, E.-O. (2000). Fallpauschalen nach dem DRG-System: Ausgangspunkt für eine Strukturreform im Krankenhausbereich oder Quelle für vielfältige Missverständnisse? Arbeit und Sozialpolitik, 54(1–2), 10–19.
Klinke, S. (2003). Ordnungspolitischer Wandel im Gesundheitssystem als Folge der Reformgesetzgebungsbemühungen, Diplomarbeit, Diplom-Studiengang Politikwissenschaft, Universität Bremen. http://www.gesundheitspolitikforschung.de/DiplGesamt.pdf. Zugegriffen: 02.01.2018.
Klinke, S. (2005a). Definition von „Medizinischer Notwendigkeit“ in Lexika und SGB V. Dokumentation von Fundstellen, Recherche im Kontext des Forschungsprojekts WAMP, FG PH, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. http://www.gesundheitspolitikforschung.de/Begriffsbestimmung_Notwendigkeit.pdf. Zugegriffen: 02.01.2018.
Klinke, S. (2005b). Entwicklung und Anwendung eines Modells zur Messung von ordnungspolitischem Wandel. Auswirkungen der gesundheitspolitischen Reformgesetzgebung auf Perzeption und Verhalten von Chefärzten im Bundesland Bremen, Discussion Papers, Bd. SP I 2005-303. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Klinke, S. (2005c). Von Menschen, Häusern und Autos. Schöpferische Zerstörung – Wie die deutsche Kliniklandschaft gesunden soll. der Freitag, 23.12.2005, 5.
Klinke, S. (2008). Ordnungspolitischer Wandel im stationären Sektor. 30 Jahre Gesundheitsreform, DRG-Fallpauschalensystem und ärztliches Handeln im Krankenhaus. Berlin: Pro BUSINESS.
Klinke, S. (2010). Elemente eines ordnungspolitischen Wandels – Auswirkungen auf das ärztliche und pflegerische berufliche Selbstverständnis. In T. Gerlinger, S. Kümpers, U. Lenhardt, & M. T. Wright (Hrsg.), Politik für Gesundheit: Fest- und Streitschriften zum 65. Geburtstag von Rolf Rosenbrock. Bern: Huber.
Klinke, S., & Müller, R. (2008). Auswirkungen der DRGs auf die Arbeitsbedingungen, das berufliche Selbstverständnis und die Versorgungsqualität aus Sicht hessischer Krankenhausärzte, ZeS-Arbeitspapier, Bd. 4. Bremen: Zentrum für Sozialpolitik.
Kolb, S., & Wolf, C. (Hrsg.). (2006). Kein einziges Märchen – Leidfaden Gesundheitswesen. Wahre Geschichten über die Ware Gesundheit. Frankfurt/M.: Mabuse.
Kühn, H. (2002). Arzt-Patient-Beziehung und ökonomische Steuerung des Arztverhaltens. In T. Meißel, & G. Eichberger (Hrsg.), Perspektiven einer künftigen Psychiatrie (S. 77–101). Linz: Edition pro mente.
Kühn, H. (2003). Ethische Probleme der Ökonomisierung von Krankenhausarbeit. In A. Büssing, J. Glaser (Hrsg.), Dienstleistungsqualität und Qualität des Arbeitslebens im Krankenhaus, Schriftenreihe Organisation und Medizin (S. 77–98). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
Kühn, H. (2004). Die Ökonomisierungtstendenz in der medizinischen Versorgung. In G. Elsner, T. Gerlinger, & K. Stegmüller (Hrsg.), Markt versus Solidarität – Gesundheitspolitik im deregulierten Kapitalismus (S. 25–41). Hamburg: VSA.
Kühn, H. (2005). Patient-Sein und Wirtschaftlichkeit. Jahrbuch für Kritische Medizin, 42, 8–25.
Kühn, H. (2006). Der Ethikbetrieb in der Medizin. Korrektur oder Schmiermittel der Kommerzialisierung, Discussion Papers, Bd. SP I 2006-303. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Kühn, H., & Klinke, S. (2007). Krankenhaus im Wandel. Zeit- und Kostendruck beeinflussen die Kultur des Heilens. Universitas, 62(1),55–62.
Kühn, H., & Simon, M. (2001). Anpassungsprozesse der Krankenhäuser an die prospektive Finanzierung (Budgets, Fallpauschalen) und ihre Auswirkungen auf die Patientenorientierung, Abschlussbericht. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. https://www.wzb.eu/www2000/bal/ph/download/kh-projekt_abschlussbericht_dlr_2.pdf. Zugegriffen: 02.12.2017.
Lauterbach, K., & Lüngen, M. (2000). DRG-Fallpauschalen: eine Einführung. Anforderungen an die Adaption von Diagnosis-Related Groups in Deutschland. Gutachten im Auftrag des AOK-Bundesverbandes. Stuttgart: Schattauer.
MBO-Ä (1997). (Muster-)Berufsordnung für die deutschen Ärztinnen und Ärzte (MBO-Ä 1997), in der Fassung der Beschlüsse des 100. Deutschen Ärztetages 1997 in Eisenach. Deutsches Ärzteblatt, 37, A-2345–2354.
Metzger, F. (2004). DRGs für Einsteiger. Lösungen für Kliniken im Wettbewerb. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
Naegler, H., & Wehkamp, K.-H. (2014). Ökonomisierung der Medizin. Ursachen, Instrumente und Folgen. Symposium: Die Ökonomisierung der Medizin, am 23. 10.2014 in der Universität Bremen.
Park, S.-J., Ahn, J.-M., Kim, Y.-H., Park, D.-W., Yun, S.-C., Lee, J.-Y., et al. (2015). Trial of everolimus-eluting stents or bypass surgery for coronary disease. New England Journal of Medicine, 372(13),1204–1212.
Reimon, M., & Felber, C. (2003). Schwarzbuch Privatisierung. Wasser, Schulen, Krankenhäuser – was opfern wir dem freien Markt? Wien: Ueberreuter.
Rothgang, H. (1996). Vom Bedarfs- zum Budgetprinzip? Die Einführung der Pflegeversicherung und ihre Rückwirkung auf die gesetzliche Krankenversicherung. In L. Clausen (Hrsg.), Gesellschaften im Umbruch. Verhandlungen des 27. Kongresses der Gesellschaft für Soziologie in Halle an der Saale 1995 (S. 930–946). Frankfurt/M, New York: Campus.
Simon, M. (2000). Kein Ende des Experimentierens: Zur geplanten Einführung eines DRG-basierten Fallpauschalensystems. In T. Gerlinger, et al. (Hrsg.), Kostendruck im Krankenhaus, Jahrbuch für Kritische Medizin (S. 10–36). Hamburg: Argument.
VdAK (2007). Sozialgesetzbuch (SGB). Ausgabe zur Gesundheitsreform. Rechtsstand: 1. April 2007. Essen: CW Haarfeld.
Vogd, W. (2004). Ärztliche Entscheidungsprozesse des Krankenhauses im Spannungsfeld von System- und Zweckrationalität. Eine qualitativ rekonstruktive Studie unter dem besonderen Blickwinkel von Rahmen („frames“) und Rahmungsprozessen, Akademische Abhandlungen zur Soziologie. Berlin: Verlag für Wissenschaft und Forschung.
Vogel, H. R. (Hrsg.). (1994). Budgetierung und Therapiefreiheit – Konsequenzen für die ärztliche Verantwortung. Stuttgart, New York: Fischer.
Weber, M. (1964). Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
Wehkamp, K.-H. (2016). Die doppelte Verantwortung und ihre Widersprüche – Chefärzte zwischen Medizin und Betriebswirtschaft? In U. Deichert, W. Höppner, & J. Steller (Hrsg.), Traumjob oder Albtraum – Chefarzt m/w: Ein Rat- und Perspektivgeber (S. 227–240). Berlin, Heidelberg: Springer.
Wilkesmann, M. (2016). Von Fürsten zu Knechten? Aktuelle Transformationsprozesse in der Organisation Krankenhaus am Beispiel der Ärzteschaft. In I. Bode, & W. Vogd (Hrsg.), Mutationen des Krankenhauses: soziologische Diagnosen in organisations- und gesellschaftstheoretischer Perspektive, Gesundheit und Gesellschaft (S. 207–228). Wiesbaden: Springer VS.
Willich, S., et al. (2005). Medikament-freisetzende versus konventionelle Stents. Deutsches Ärzteblatt, 46, A-3180/B-2685/C-2513.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2018 Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Klinke, S. (2018). Das berufliche Selbstverständnis von ÄrztInnen im DRG-Krankenhaus. In: Klinke, S., Kadmon, M. (eds) Ärztliche Tätigkeit im 21. Jahrhundert - Profession oder Dienstleistung. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56647-3_7
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-56647-3_7
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-662-56646-6
Online ISBN: 978-3-662-56647-3
eBook Packages: Medicine (German Language)